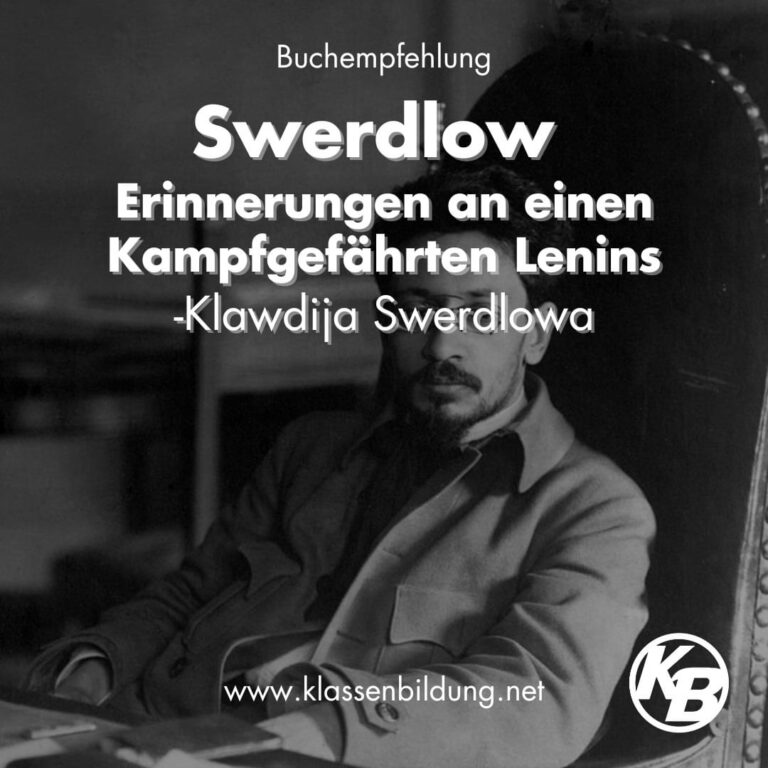„Die Gefallenen sind unsterblich“ – eine Parole, die manch einem sehr vertraut vorkommen wird und bei anderen mehr Fragen als Antworten aufwirft. Mit Gedenken verbinden viele von uns den Grabbesuch eines Familienasngehörigen, das Tragen schwarzer Kleidung und das Trauern um Personen, die nicht mehr bei uns sind. Mit der Organisierung in revolutionären Kreisen kommt man aber mit einer Gedenkkultur in Kontakt, die nur noch sehr wenig mit dem bürgerlichen Trauern um Verstorbene zu tun hat, wie man es eigentlich kennt.
Es wird nicht mehr Menschen gedacht weil sie Familienmitglieder waren, sondern Revolutionär:innen und Menschen, die im Kampf gegen den Klassenfeind ihr Leben gelassen haben. Dabei geht es nicht selten um Menschen, die man nicht kennt, oder die teilweise bereits viele Jahrzehnte verstorben sind. Es werden Demonstrationen und Kulturveranstaltungen organisiert, Vorträge gehalten, Lieder geschrieben oder sogar ganze Monate den Gefallenen gewidmet. In Deutschland sind die jährlich stattfindende LLL-Gedenkdemonstration (LLL steht für die Kommunist:innen Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Wladimir I. Lenin) im Januar in Berlin oder Erzählungen über die Duisburger Kommunistin Ivana Hoffmann erste Berührungspunkte vieler junger Revolutionär:innen mit kommunistischem Gedenken.
Doch wozu das Ganze? Der Antwort auf diese Frage wollen wir uns in diesem Text annähern. Was genau ist revolutionäres Gedenken eigentlich und warum setzen wir uns überhaupt damit auseinander? Wie unterscheidet sich revolutionäres vom bürgerlichen Gedenken und welche Rolle spielen gefallene Revolutionär:innen und Vorbilder für unseren Kampf? Darüber hinaus wollen wir aber auch einen Blick auf die Traditionen der Gedenkkultur in der kommunistischen Bewegung werfen und uns die Frage stellen, vor welchen Herausforderungen wir heutzutage stehen, das Gedenken an unsere Genoss:innen und Klassengeschwister weiterzuentwickeln.
Bürgerliches Gedenken und seine Funktion
Um sich besser vorstellen zu können, was wir unter revolutionärem Gedenken verstehen, lohnt es sich, zuerst bei dem zu beginnen was wir kennen. Auch wenn wir schnell feststellen werden, dass sich die verschiedenen Gedenkformen kaum stärker unterscheiden könnten. Das Gedenken, was die meisten von uns zuerst kennenlernen, ist ein Gedenken, was von der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Wertvorstellungen geprägt ist. Ein Familienmitglied verstirbt, die Familie und enge Angehörige kommen zusammen, alle tragen schwarze Kleidung und trauern um eine Person, die nicht mehr am Leben ist. Oft versucht man sich gegenseitig – selbst wenn man nicht religiös ist – mit dem idealistischen Glauben an ein Leben nach dem Tod noch Hoffnung zuzusprechen, dass man der Person nach dem eigenen Tod wieder begegnen und die Trennung nicht für immer andauern würde.
Neben persönlichem Gedenken an verstorbene Angehörige gibt es aber auch noch andere Formen des bürgerlichen Gedenkens. So gibt es unzählige bürgerliche Vorbilder, denen in unserer Gesellschaft aufgrund ihrer angeblich so erstrebenswerten Eigenschaften und Lebensweise ein sehr hoher Stellenwert zugeschrieben wird. Nicht selten wird dann prominenten Sänger:innen, Schauspieler:innen oder ehemaligen Politiker:innen nachgetrauert. Dabei stehen gerade diese Persönlichkeiten, die Rolle und die Werte, welche sie vertreten, stellvertretend für die Gesellschaft, die wir Revolutionär:innen überwinden wollen. Damit lässt sich auch erklären, warum Vertreter:innen des Kapitals wie dem ehemaligen Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schäuble gedacht wird, der in seiner Lebzeit für die Verelendung der griechischen Bevölkerung oder die Annexion der DDR und damit der Zerstörung unzähliger Existenzen ostdeutscher Arbeiter:innen verantwortlich war.1
Die bürgerliche Gedenkkultur versucht sich aber auch an weniger individualistischen Gedenkbräuchen. So wird vielerorts am Tag der Reichspogromnacht oder zum Jahrestag des Hanau-Anschlags den Opfern gedacht und auch vom deutschen Staat und bürgerlichen Initiativen Gedenkveranstaltungen organisiert. Diese unter dem Begriff der „Erinnerungskultur“ bekannte Gedenkpraxis kann sich aber nur innerhalb der Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft bewegen. So wird bei solchen Gedenkveranstaltungen nie die Frage gestellt, wie es eigentlich zum deutschen Faschismus kommen konnte, welche Rolle der deutsche Staat im Aufstieg und der Machtergreifung der Faschist:innen spielte oder bei den Morden in Hanau, Halle oder Celle.2
Was die verschiedenen Formen bürgerlichen Gedenkens alle gemeinsam haben: Sie sollen vor allem als Ventil und Verarbeitung für die eigenen Trauergefühle dienen und ja nicht den Status Quo hinterfragen. Bürgerliches Gedenken ist im Wesentlichen also eine Trauer- und Erinnerungskultur, die eben genau das in den Mittelpunkt stellt: Trauern und Erinnern. Sie geht nicht über das einfache Erinnern an jemanden oder etwas hinaus. Bürgerliches Gedenken verewigt die bestehenden Verhältnisse, anstatt sie zu verändern und ist damit mehrheitlich eine passive Form des Gedenkens.
Das muss sie auch sein, denn die vorherrschende Form des Gedenkens – beziehungsweise im weiteren Sinne von Kultur als Ganzem – muss den Interessen der herrschenden Klasse dienen. Würde uns Gedenken dazu auffordern, die Verhältnisse und Umstände zu hinterfragen, die zu den Opfern geführt haben, müssten wir gegen das dahinterstehende System aktiv werden. Das kann sich die herrschende Klasse nicht erlauben und schafft deswegen ihre eigene, bürgerliche Kultur und Gedenken.
Wie wir herausgestellt haben, ist der Charakter des bürgerlichen Gedenken vor allem durch seine Passivität, seinen emotionalen Gehalt und das Bewahren und Aufrechterhalten bürgerlicher Werte, Normen und im Endeffekt auch der bürgerlichen Klassenherrschaft definiert. Wie sieht nun eine revolutionäre Gedenkkultur aus?
„Gedenken heißt kämpfen“
Wenn bürgerliches Gedenken die Werte und Normen der herrschenden Klasse im Kapitalismus vertritt, dann muss revolutionäres Gedenken als Teil proletarischer Kultur auch die Interessen des Proletariats und aller Unterdrückten und Ausgebeuteten zum Ausdruck bringen. Uns eint das Ziel, die Ursache unserer Unterdrückung und Ausbeutung, die kapitalistisch-patriarchale Klassenherrschaft, ein für alle Mal hinter uns zu lassen und diese im revolutionären Prozess und mit dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft zu überwinden. Hieraus können wir bereits eine erste zentrale Charaktereigenschaft revolutionären Gedenkens ziehen und zwar, dass das Gedenken ein Teil unserer politischen Praxis sein muss und dementsprechend auch nicht losgelöst von den aktuellen Entwicklungen des Klassenkampfes gesehen werden darf.
Gedenken darf für uns Revolutionär:innen und Kommunist:innen niemals ein Selbstzweck sein. Es muss immer Ausdruck des sich verändernden und fortführenden Klassenkampfes für den Kommunismus sein und ergibt sich letztendlich auch aus dessen Notwendigkeit. Denn ohne Klassenkampf gäbe es keine Genoss:innen, die im Streben nach einer anderen Gesellschaft und dem Widerstand gegen das System gefallen sind. Gefallene und ihr Tod sind dementsprechend also immer als das Ergebnis und eine Konsequenz des revolutionären Kampfes zu betrachten und zu verstehen. Gedenken ist für uns also keineswegs ein passiver Akt, sondern das genaue Gegenteil: ein Aufruf zum Handelnund Eingreifen in die bestehenden Verhältnisse. Das ist der Inhalt und die Bedeutung der Parole „Gedenken heißt Kämpfen“.
Wenn wir an Revolutionär:innen, kämpfende Arbeiter:innen oder Antifaschist:innen erinnern, dann immer mit dem Hintergrund, dass sie von ein und demselben System gerichtet wurden und ihr Leben dem Kampf dagegen gewidmet haben. Damit sind alle verstorbenen Revolutionär:innen, alle hingerichteten Arbeiter:innen auch immer ein Weckruf, den Kampf gegen das imperialistische Weltsystem aufzunehmen und es ihnen gleich zu machen und unser aller Kraft dem Kampf für eine bessere Gesellschaft zu widmen.
Was uns mit den Menschen, denen wir gedenken, verbindet, ist also nicht zwangsmäßig eine persönliche Beziehung oder familiäre Verwandtschaft. Teilweise gedenken wir Personen wie Wladimir Iljitsch Lenin, der nicht nur in einem anderen Land, sondern auch einem anderen Jahrhundert gelebt hat. Was uns mit Menschen wie zum Beispiel Lenin verbindet, ist unsergemeinsames Ziel der Überwindung der kapitalistischen und patriarchalen Klassenherrschaft im Kommunismus. Dieses Ziel verbindet uns, so wie die gesamte Arbeiter:innenklasse weltweit, über Ländergrenzen, Altersunterschiede oder sogar über Jahrhunderte hinweg miteinander.
Heißt das, dass wir bei revolutionärem Gedenken nicht trauern oder weinen dürfen? Natürlich nicht. Gerade weil wir mit den Gefallenen eben nicht (nur) eine persönliche Beziehung teilen, sondern Teil derselben unterdrückten Klasse sind, vor denselben Hürden und schwierigen Entscheidungen stehen wie sie in ihrer Lebzeit, dieselben Niederlagen und Erfolge gemacht haben und das selbe Bewusstsein und Einsicht in die Notwendigkeit besitzen, dieses marode System hinter uns zu lassen, verbindet uns viel mehr mit ihnen als mit bürgerlichen Idolen.
Tiefe Trauer und Schmerz zu empfinden, wenn der Klassenfeind einen von ihnen aus unseren Reihen reißt, ist mehr als verständlich. Selbst sich mit der Lebensgeschichte längst verstorbener Genoss:innen zu identifizieren und deshalb Trauer zu empfinden, wird auf dieser Ebene schnell nachvollziehbar. Dennoch müssen wir unsere unsterblich gewordenen Genoss:innen als Ansporn und Inspiration für die Fortführung und Hebung unseres Kampfes sehen. Die Wurzel unserer Trauer und dem Tod aller Märtyrer:innen ist das imperialistische Weltsystem. Dabei dürfen wir aber nicht in die Falle tappen, uns von unseren Gefühlen überwältigen und lähmen zu lassen. Vielmehr gilt es unsere Trauer und Wut in die Tat umzusetzen, sie zu einer die gesellschaftlichen Verhältnisse umwälzenden Kraft zu verwandeln und uns zum Handeln zu bewegen. Alles andere würde lediglich zum Stillstand und damit Konservierung des Status Quo führen.
Revolutionäre Vorbilder und Revolutionierung der Persönlichkeit
Setzen wir uns nun kurz mit der Frage der Vorbilder und unserer eigenen Rolle im Prozess des revolutionären Gedenkens auseinander. Während kommunistischem Gedenken gerne die Idolisierung von einzelnen Revolutionär:innen vorgeworfen wird, ist es vor allem das bürgerliche Gedenken, welches ihren Vorbildern eine Unfehlbarkeit zuweist. Nach dem Tod Queen Elisabeths II. wurden im ganzen Land riesige Trauerfeiern von bürgerlicher Seite abgehalten, um der 96-jährigen Imperialistin zu gedenken. Jegliche Kritik an ihrer Person oder ihrer Rolle als Vorzeigegesicht des britischen Imperialismus und Kolonialismus wurde als geschmacklos oder unangebracht abgestempelt.
Uns kann es jedoch nicht darum gehen, unsere Genoss:innen oder Revolutionär:innen auf ein Podest zu heben und als die „perfekten Widerstandskämpfer:innen“ darzustellen. Eine solche Herangehensweise ist nicht nur schädlich, sondern widerspricht auch unserer grundlegenden Weltauffassung, nach welcher wir versuchen, uns der Realität und damit objektiven Wahrheit immer weiter anzunähern. Und was klar ist: Alle unsere Vorbilder haben Fehler gemacht. Sie haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, nicht immer die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Dennoch haben sie immer wieder eine richtige Entscheidung getroffen – weiter zu kämpfen.
Lenin, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Ivana Hoffmann und so weiter sind Vorbilder für uns. Nicht weil sie perfekt waren, sondern weil sie Alles für die Befreiung unserer Klasse und aller Unterdrückten weltweit gegeben haben. Sie sind die Schritte gegangen, die die Anforderungen der Revolution an sie damals gestellt hat und die auch heute an uns gestellt werden.
Wenn wir gefallenen Genoss:innen gedenken, dann machen wir das nicht, um ihre individuellen Erfolge zu loben oder irgendeinen „Totenkult“ aufrechtzuerhalten. Wir gedenken ihnen, um das Erbe, welches sie für die Befreiung der Arbeiter:innenklasse gelassen haben, nicht zu vergessen, uns ihre Lehren anzueignen und ihre Fehler nicht wieder zu begehen.
Mit jedem unserer gefallenen Genoss:innen wächst also auch der Anspruch an uns selbst, die Lücke, die ihr Tod in unseren Reihen hinterlassen hat, zu füllen. Es geht aber nicht darum, an ihrem Grab in Trauer und Wehmut zu verweilen. Es geht darum, die Fahnen unserer gefallenen Genoss:innen voller Stolz und Tatendrang wieder aufzunehmen und den steinigen Weg, den sie bereits gegangen sind, ebenfalls zu gehen und unser Bestes zu geben, eines Tages sagen zu können: „Ich habe unsere Fahne zum Ziel gebracht, Genoss:in“.
Deswegen sprechen wir auch davon, dass unsere Genoss:innen „unsterblich“ geworden sind. Denn das, wofür sie eingestanden haben, das, was sie und ihr Leben definiert hat, wird erst mit seinem erfolgreichen Triumph über den Kapitalismus enden und lebt deswegen in uns allen heute weiter.
Ihr Tod ist dabei also immer auch ein Aufruf, uns selbst zu revolutionieren und die eigenen Grenzen zu sprengen, die wir davor vielleicht noch nicht bereit waren einzureißen. Letztendlich ist Gedenken nicht nur ein wichtiger Bestandteil revolutionärer Kultur, sondern ebenso eine Chance das eigene politische Kollektiv zu stärken. Sich mit den Gefallenen und ihrem Leben, den Widersprüchen und Herausforderungen, die sich ihnen gestellt haben, auseinanderzusetzen, ermöglicht es, unser eigenes Verständnis und Bewusstsein über die Notwendigkeit des revolutionären Kampfes und dessen Ernsthaftigkeit weiter zu vertiefen, die gemeinsamen Schritte und Errungenschaften unserer Klasse anzuerkennen und wertzuschätzen und neue Schritte zu wagen.
Wie sieht revolutionäres Gedenken aus?
Nachdem wir uns ein Bild über revolutionäres Gedenken auf theoretischer Ebene gemacht haben, stellt sich die Frage: Wie sieht revolutionäres Gedenken in der Praxis aus? Gedenkt man Revolutionär:innen auch nur auf dem Friedhof? Dafür wollen wir einen kurzen Sprung in die Vergangenheit wagen, aber auch auf die Gedenkkultur der revolutionären Bewegung heute schauen.
Was klar ist: Revolutionäres Gedenken muss weitaus mehr sein, als einmal im Jahr das Grab verstorbener Genoss:innen zu besuchen. Revolutionäres Gedenken fordert uns zum Handeln und Verändern auf. Das muss sich also auch in der Umsetzung widerspiegeln. Gedenken kann dementsprechend viele verschiedene Formen annehmen. Der Grabbesuch ist lediglich eine Möglichkeit, um die Erinnerung an Genoss:innen aufrechtzuerhalten.
Gerade im Osten Deutschlands ist man des Öfteren mal mit Namen von Kommunist:innen konfrontiert. Ob es nun die vielen sowjetischen und sozialistischen Denkmäler oder die zahlreichen nach Kommunist:innen benannten Straßensind. Viele von ihnen sind noch Überreste aus DDR-Zeiten, in welcher sozialistische Gedenkkultur einen anderen Wert hatte als in der westlichen BRD und wo viele Straßen und öffentliche Orte, die ursprünglich während des Hitlerfaschismus nach Faschist:innen benannt wurden, bis heute die Namen von Revolutionär:innen und Antifaschist:innen tragen. Damals waren sie vor allem Ausdruck der sozialistischen Ausrichtung der DDR und Sowjetunion, aber auch im Besonderem der Politik der Entnazifizierung nach 1945. Heute spielen sie oft keine große Rolle in der Öffentlichkeit mehr, außer wenn es um ihre Umbenennung oder Brandmarkung geht. So zum Beispiel in Tübingen, wo die Clara-Zetkin-Straße im vergangenen Jahr mit einem „Knoten“ wegen der „Demokratiefeindlichkeit“ ihrer Namensgeberin markiert werden sollte, der sonst für Faschist:innen und Kolonialherren vorbehalten ist.
Die Geschichte unserer Genoss:innen nicht zu vergessen, kann aber auch in Form von Texten und Büchern passieren. Die Verarbeitung in Form von Texten ist ebenso Teil einer revolutionären Gedenkkultur, die neben theoretischen Werken für die Bewusstseinsentwicklung und die Vertiefung unseres Verständnisses für den revolutionären Klassenkampf von großer Bedeutung sind. Oft berichten sie über das Leben, den Kampf und die damit verbundenen Schwierigkeiten und großen Fragen, die sich den Revolutionär:innen gestellt haben.
In Klawdija Swerdlowas Biographie3 über ihren engen Genossen, Vertrauten und Lebensgefährten Jakow Michailowitsch Swerdlow bekommt man zum Beispiel nicht nur einen genaueren Einblick in die Tätigkeit des jugendlichen ZK-Mitglieds der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU). Man erfährt eben soviel über die besonderen Hürden und besonderen Eigenschaften Swerdlows, die Voraussetzung für die erfolgreichen Vorbereitungen der ersten sozialistischen Revolution in der Menschheitsgeschichte waren. Und auch die Romane über die beiden Genoss:innen Ivana Hoffmann4 und Erkut Direkci5, die in Kurdistan und der Türkei tapfer kämpften, lassen uns die Gefallenen näher kennenlernen.
Darüber hinaus bewahren die Romane, die nicht von einzelnen Genoss:innen, sondern von geschichtlichen Ereignissen handeln, gleichermaßen ein Stück der Geschichte unserer Klasse. So zum Beispiel in Alexander Beks sowjetischem Roman „Wolokolamsker Chaussee“. Der nicht nur die Erinnerung an vergangene Kämpfe aufrecht erhält, sondern diese nutzt um kommunistische Moral und revolutionären Optimismus weiter zu vermitteln. 1941 befahl Hitler den Sturm auf Moskau. Mutige Rotarmist:innen stellten sich den Faschist:innen in den Weg und gewannen trotz massiver Unterzahl und gigantischer Verluste.
Bücher sind damit nicht nur ein Mittel, unsere Genoss:innen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Mit ihnen haben wir die Möglichkeit, ihre revolutionären Eigenschaften zu unseren zu machen, die Geschichtsschreibung in die eigene Hand zu nehmen und der schieren Unendlichkeit bürgerlicher Propaganda eine Alternative entgegenzustellen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Gedenkkultur ist Kunst und Kultur. Portraits von Genoss:innen, Gedichte über ihr Leben, Gemälde über Aufstände und Volkserhebungen gegen das kapitalistische System oder revolutionäre Festivals wie das jährliche Ivana Hoffmann Festival oder das Hans Beimler Festival in Augsburg mit Musik- und Kulturauftritten, revolutionärer Literatur und so weiter gehören zu unserer Gedenkkultur dazu.
Die Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei Türkei/Kurdistans (MLKP) widmet jedes Jahr mit ihren Novembertagen sogar einen gesamten Monat den Gefallenen. Der „Monat der Unsterblichen“6 ist für sie ein Aufruf an alle Revolutionär:innen. Er ist ein Monat der Selbstkritik, Veränderung und Aktion.
In einem Artikel ihres Parteiorgans Partinin Sesi (Stimme der Partei) aus dem Jahr 2018beschreiben sie die Bedeutung des Gedenkens wie folgt: „Eine Zeit, in der wir die größten Schwierigkeiten mit der Unbekümmertheit auf uns nehmen Blut spuckend ,ich habe Himbeersaft getrunken‘ zu sagen. Eine Zeit revolutionärer Geduld, revolutionärer Wut und revolutionärer Entschlossenheit. Zeit, die vordersten Kampflinien weiter nach vorne zu verlegen, der Vorhutentschlossenheit Qualität zu verleihen. Zeit, mehr als je zuvor organisiert, diszipliniert und die Regeln einhaltend zu handeln. Zeit, auch nicht den kleinsten Energieverlust zuzulassen. Zeit, die Messlatte der Anleitung der eigenen Entwicklung höher anzusetzen.“
Revolutionäre Gedenkdemonstrationen
Gedenkdemonstrationen haben eine lange Tradition in der kommunistischen Bewegung. So gibt es seit über 100 Jahren eine Gedenkdemonstration in Berlin anlässlich der Tode Rosa Luxemburgs, Karl Liebknechts und Wladimir Iljitsch Lenins. Dazu unten aber mehr.
Auch in Wuppertal, der Geburtsstadt des marxistischen Vordenkers Friedrich Engels, wird um seinen Todestag am 5. August seit einigen Jahren eine Gedenkdemonstration organisiert. In Kontrast zu dem von der Stadt gezeichnetem Bild Engels, nach dem er lediglich ein Philosoph, Fabrikantensohn und Wuppertaler war, betont das Bündnis immer wieder sein unersetzliches Erbe für die revolutionäre Arbeiter:innenbewegung und seinem Kampf für die Diktatur des Proletariats. Hier zeigt sich immer wieder ganz praktisch, dass die revolutionäre Gedenkkultur dem Staat ein Dorn im Auge ist. 2021 eskalierte die Polizei die Demonstration mit willkürlicher Provokation und Gewalt und gegen alle Teilnehmer:innen wurden Verfahren eingeleitet, von denen fast alle wieder eingestellt werden mussten. Noch heute laufen einige Verfahren wegen angeblichen Landfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Ein weiterer sehr prägender Moment in der näheren Geschichte kommunistischen Gedenkens in Deutschland war die Gedenkdemonstration anlässlich des Todes der deutschen Internationalistin und Kommunistin Ivana Hoffmann. Ende 2014 entschied sie sich als Teil ihrer Partei der MLKP und den kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG/YPJ nach Syrien zu gehen und dort den Kampf gegen die Faschist:innen des Islamischen Staates (IS) aufzunehmen. Am 7. März 2015 fiel die Genossin, auch unter ihren Kampfnamen Avaşin Tekoşin Güneş bekannt, bei der Verteidigung des syrischen Dorfes Til Temir. Daraufhin versammelten sich tausende Menschen zu ihrem Begräbnis in Duisburg.
Seit mehr als 100 Jahren werden im Januar die Straßen Deutschlands von einer der größten (Gedenk-)Demonstrationen mit kommunistischen Inhalten in Europa mit einem Meer an roten Fahnen geschmückt: Der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration (LLL). Doch was ist die LLL und warum hat sie für die kommunistische Bewegung in Deutschland eine so große Bedeutung?
Die LLL-Demonstration findet jährlich am zweiten Januarwochenende, um die Todestage der beiden deutschen Kommunist:innen und Mitbegründer der KPD, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und dem russischen Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin, in Berlin statt. Nach der Ermordung Karl und Rosas durch faschistische Banden auf direkten Befehl des SPD-Politikers Gustav Noske von der KPD 1919 in der Weimarer Republik eingeführt, versammeln sich auch 100 Jahre später noch zahlreiche kommunistische, revolutionäre und antikapitalistische Kräfte, um ihnen zu gedenken.
Die Demonstration startet traditionell am Frankfurter Tor und läuft bis zur Gedenkstätte der Sozialisten, wo Karl und Rosa begraben liegen. Bis zur Machtergreifung der Faschist:innen 1933 wurde das Gedenken regelmäßig praktiziert. Danach wurde es von den Faschist:innen strikt verboten und die Teilnehmer:innen der letzten LLL 1933 massenhaft verfolgt und verhört.
Die Kriminalisierung der LLL begann aber nicht erst im Hitlerfaschismus. Sie war bereits davor immer wieder Angriffen durch den Staat ausgesetzt. So wurde 1930 die Berliner LLL-Feier vom preußischen Polizeipräsidenten Karl Zörgiebel (SPD) verboten und viele der Teilnehmer:innen verhaftet und misshandelt. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 und der Errichtung der sowjetischen Besatzungszone 1946 haben dann wieder Gedenkveranstaltungen stattfinden können und mit der Gründung der DDR ab 1949 zentrale Veranstaltungen der regierenden SED.
Lenin war führender Kommunist der Bolschewiki, die im Februar 1917 sowohl den russischen Zaren stürzten und als auch wenige Monate später mit der Oktoberrevolution den ersten erfolgreichen Anlauf einer sozialistischen Revolution und mit der Sowjetunion den ersten sozialistischen Staat errichteten. Luxemburg und Liebknecht hingegen waren führende Köpfe in der revolutionären Sozialdemokratie und kommunistischen Bewegung in Deutschland. Sie nahmen eine führende Rolle bei der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands ein.
Sie alle spielten insbesondere während des ersten Weltkrieges eine große Rolle darin, Klarheit innerhalb der Arbeiter:innenbewegung zu schaffen, wie man sich zu dem großen imperialistischen Krieg der Herrschenden positionieren sollte. Sie kämpften damals vor allem gegen die Politik des Burgfriedens und der Vaterlandsverteidigung, die den proletarischen Klassenstandpunkt aufgeben und sich mit den Kriegstreibern im eigenen Land versöhnen wollte.
Sie alle betonten dabei immer die Notwendigkeit, dem imperialistischen Krieg den Kampf anzusagen und diesen in einen revolutionären Bürgerkrieg gegen die kriegstreibenden Herrschenden und das gesamte imperialistische System umzuwandeln. Gerade jetzt in Zeiten, wo sich die Imperialisten wieder auf einen neuen dritten Weltkrieg vorbereiten und ihre Kriegsmaschinen aufrüsten, müssen wir die Lehren, die Lenin, Luxemburg und Liebknecht uns mit auf den Weg gaben, und für die sie mit ihrem Leben bezahlten, uns zu Herzen nehmen.
Probleme in der Praxis und Ansätze zu ihrer Weiterentwicklung
Zuletzt wollen wir uns anschauen, vor welchen Aufgaben wir heute stehen, revolutionäres Gedenken weiterzuentwickeln. Auch wenn es bereits einige Ansätze für eine revolutionäre Gedenkkultur gibt, so stoßen wir trotzdem auf einige Probleme in der Praxis, die uns dazu anregen sollten, neue Schritte zu gehen.
Nicht selten kommt es auch bei Gedenkveranstaltungen mit revolutionärem Anspruch vor, dass diese noch von einem falschen, bürgerlichen Verständnis von Trauerkultur geprägt sind. So begleitet oft eine trauernde und leidvolle Stimmung unser Gedenken: Es wird über das Leben der Verstorbenen erzählt, man singt vielleicht ein zwei Lieder und legt Blumen nieder. Die Stimmung danach ist eher bedrückt und ruhig. Stattdessen müssen wir den Anspruch stellen, ein neues, revolutionäres Verhältnis zum Tod unserer Genoss:innen zu entwickeln und uns nicht von Gefühlen der Trauer, Zerrissenheit und Niedergeschlagenheit überwältigen zu lassen.
Als logische Schlussfolgerung muss diese Schärfung unseres Bewusstseins auch bedeuten, die Parole „Gedenken heißt Kämpfen“ wirklich zur Realität werden zu lassen. Was bedeutet kämpfen? Es bedeutet sich gegen den Klassenfeind aufzurichten und Widerstand zu leisten. Es bedeutet nicht nur die ideologische Umkreisung der bürgerlichen Gesellschaft in unserem Bewusstsein zu durchbrechen, sondern auch ganz praktisch in die direkte Konfrontation mit dem System zu gehen. Angriffe wie auf die LLL 2024 dürfen wir nicht nur als Angriff auf eine beliebige Demo verstehen, sondern als eine Kampfansage unseres Klassenfeindes gegen uns als Bewegung, gegen unser Ziel, unseren Kampf und unser revolutionäres Gedenken.
Zudem stehen wir hier in Deutschland spezifisch vor der Herausforderung, überhaupt wieder eine „eigene“ revolutionäre Gedenkkultur zu schaffen. Oft vergessen wir es selbst, dass es mal eine Zeit gab, in der Deutschland nicht nur imperialistisches, sondern auch revolutionäres Zentrum war. Die deutsche kommunistische Bewegung war trotz ihrer vielen Mängel eine der Größten und Bedeutendsten in der Geschichte unserer Klasse. Mit der Errichtung der wohl bisher brutalsten Ausprägung imperialistischer Herrschaft mit dem Hitlerfaschismus, der danach relativen Stabilisierung und Erstarken des deutschen BRD-Imperialismus und der ideologischen und politischen Zerfaserung der kommunistischen Bewegung herrscht eine große Diskontinuität, was revolutionäre Praxis aber dementsprechend auch revolutionäres Gedenken angeht.
Dass es also keine ausgeprägte Gedenkkultur gibt, ist gar nicht verwunderlich, denn immerhin entsteht eine Gedenkkultur nicht am Schreibtisch, sondern vor allem in der Praxis, im revolutionären Kampf. Schauen wir uns aber gerade den Klassenkampf in Deutschland an, können wir zwar einen Anstieg der Aktivität unserer Klasse erkennen. Dennoch kann man heute nicht davon sprechen, dass wir eine Unmenge an direkter Erfahrung mit im Klassenkampf gegen den deutschen Imperialismus Gefallenen in den eigenen Reihen haben. Ganz anders sieht das zum Beispiel in der Türkei und Kurdistan aus, wo sich Organisationen teils seit Jahrzehnten in direktem militärischen Widerstand gegen Repression und Faschismus wehren und bereits viele ihrer Genoss:innen in diesem Kampf gefallen sind.
Und auch wenn wir vielleicht keine Genoss:innen im Schusswechsel mit dem Klassenfeind verloren haben, sind dennoch Genoss:innen, die tagtäglich mit uns auf den Straßen standen, aus unseren Reihen gegangen, weil sie zum Beispiel eines natürlichen Todes bzw. an Krankheiten gestorben sind. So auch Genosse und MLKP-Gründungsmitglied İbrahim Okçuoğlu, der am 24. August 2023 an einer Krebserkrankung in Berlin verstarb.
Zudem ist unser Gedenken in den meisten Fällen immer noch an „bekannte Gesichter“ und große Persönlichkeiten wie Marx, Engels und Lenin gekoppelt. Aber auch den tausenden Menschen, die beispielsweise in der Oktoberrevolution oder als Teil der Roten Armee im Krieg gegen den deutschen Faschismus gefallen sind, gebührt unsere Erinnerung und Wut. Revolutionäres Gedenken muss alle Kämpfenden gegen Unterdrückung und Ausbeutung einschließen, nicht nur einige wenige bekannte.
Wir müssen darüber hinaus aber noch viel größere Schritte gehen. Unser Verständnis vom Sinn und den Zielen von Gedenken und dem aktuellen Stand der revolutionären Gedenkkultur erfordert von uns weitaus mehr. Letztendlich müssen wir – ideologisch, kulturell und politisch umkreist vom Imperialismus – uns an die Aufgabe herantrauen, einevollständig neue, revolutionäre Kultur zu schaffen, die nicht nur alle fortschrittlichen Elemente anderer Kulturen übernimmt und ihre rückschrittlichen Elemente bekämpft. Wir müssen eine Kultur schaffen, die unsere Klasse in ihren Bann zieht und am konsequentesten unsere Interessen der Überwindung jeglicher Unterdrückung und Ausbeutung zum Ausdruck bringt.
Das bedeutet nicht, bei unserem jetzigen Stand stehen zu bleiben. Es gilt das revolutionäre Erbe unserer Klasse und ihrer Kämpfe am Leben zu halten. Denn eins kann man sich sicher sein: Wenn wir es nicht machen, dann wird es niemand machen. In Zukunft gilt es also diesen Bereich weiter auszubauen: Eigene Lieder und Bücher über das Leben von Revolutionär:innen und die Klassenkämpfe in Deutschland zu verfassen, Filme, Gedichte, Gemälde und so weiter zu schaffen.
Doch viel wichtiger ist: Für revolutionäre Kultur benötigt es revolutionäre Klassenkämpfe. Gibt es keine Revolutionär:innen, die kämpfen, wird man auch keine Bücher über ihr Leben schreiben können; wird es auch keine neuen Erfahrungen geben, aus denen wir unsere Lehren ziehen und den Klassenkampf zuspitzen können. Eine wahre revolutionäre Gedenkkultur kann nur im Kampf entstehen für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung.
1 https://perspektive-online.net/2023/12/wolfgang-schaeuble-nicht-bequem-aber-loyal-gegenueber-dem-kapital/
2 https://perspektive-online.net/2024/02/4-jahre-hanau-vereint-und-selbstorganisiert-gegen-faschistische-gewalt/
3 https://www.klassenbildung.net/buchrezension-swerdlow-erinnerungen-an-einen-kampfgefaehrten-lenins
4 https://www.klassenbildung.net/buchempfehlung-ivana-hoffmann-ein-leben-voller-liebe-und-hoffnung
5 https://www.klassenbildung.net/buchempfehlung-mein-leib-und-leben-fuer-den-kampf-die-geschichte-von-erkut-direkci
6 http://www.mlkp-info.org/?kategori=1212&icerik_id=10914&Revolution%C3%A4rer_Novembergeist